Selten, nein, noch nie hat es im Vorfeld eines Albums so eine Promophase gegeben wie bei „King„, dem neuen Werk von Kollegah. Was der junge Wahldüsseldorfer da an Registern zog, verdiente jederzeit das Attribut bosshaft.
Wie er das YouTube-Spiel nach seinen eigenen Regeln durchzog, wie er seine Rolle als Comedian zuerst ausbaute und schließlich perfektionierte, wie er dann plötzlich den ernsthaften, ja politischen Kolle auspackte und Geld an Waisen spendete, dazu eine ganze Armada von Freetracks auf das Publikum losließ, die mal klamaukig bis ballermannesk, dann wieder geheimnisvoll-verschwörungstheoretisch daherkamen, das alles sollte jedem Major-A&R als praktischer Anschauungsunterricht dienen. So, liebe Freunde, wird’s gemacht. So erzeugt man die maximale Aufmerksamkeit für ein Produkt, das man verkaufen will.
Nun ist es freilich so, dass wie in den allermeisten Fällen die offensive Werbestrategie dem potentiellen Käufer Sand in die Augen streut. Angesichts der Wucht und auch der Qualität des betriebenen Aufwands könnte der nämlich durchaus übersehen, dass der eigentliche Inhalt, das Album „King„, so spektakulär und ungewöhnlich nun auch wieder nicht ist. Eigentlich ist es auch nur das, was Kollegah bereits seit den Tagen seiner „Zuhältertapes“ tut: Extrem sauber geflowte, extrem gut ausgedachte Vergleiche, deren Inhalt ungefähr um drei Themen kreisen: Muskeln, Macht, Muschis.
Gut, wie angekündigt verzichtet Kollegah dieses Mal dankenswerterweise wieder auf die Plastikhooks des letzten Albums „Bossaura“ und ja, in Songs wie „Alpha“ oder „Du bist Boss“ gibt er soviel Einblick in den Felix Antoine Blume hinter der Kunstfigur Kollegah, wie bisher kaum einmal. Ansonsten aber ist alles beim alten geblieben.
„Ich steig‘ aus dem Flieger, greife zum iPhone
Flightmode aus, ich änder‘ den Timecode
Liveshows, Groupies wollen Blunts
Zu viele Hater, zu wenig Guns“ („Flugmodus„)
„Du hast Geldprobleme? Suchst besorgt nach Halt?
Ich hab‘ auch Geldprobleme – Mein Tresor platzt bald“ („Warum hasst du mich„)
Klar ist das alles wahnsinnig unterhaltsam, klar macht der Kollegah-Effekt, der sich einstellt, wenn man einer der doppeldeutigen Lines zum ersten Mal hört und sie decodiert, immer wieder Spaß. Und klar schnalzt jeder Technikfreund mit der Zunge, wenn Kollegah seine acht- bis zehnsilbigen Reime auspackt. Auch die auf die Spitze getriebene, sorgsam kultivierte Überheblichkeit funktioniert jedes Mal aufs neue prächtig.
Die beschriebenen Qualitäten ziehen sich praktisch durch alle Songs von „King„, vor allem im letzten Anspielpunkt „Omega“ bringt Kollegah alle seine Qualitäten nochmal so richtig auf den Punkt. Eine fünfeinhalbminütige Demonstration der Stärke, technisch perfekt, alle Schwanzvergleiche dürfen danach als gewonnen betrachtet werden.
„Dein Alkivater schläft seinen Rausch aus, steht auf, kann sich kaum normal bewegen
Fängt zu saufen an um zehn und will erstmal ein Glas um die Uhrzeit exen, wie im Dinosauriermuseum
Okay, okay, der braucht wieder ein bisschen
Dein Dad ruft wegen Stoff an: Der braucht wieder n bisschen“ („Omega„)
Nur wie gesagt: Das hat Kollegah auch alles schon vorher drauf gehabt. Wenn er also tatsächlich der King of Rap sein sollte (und dafür spricht momentan wirklich viel, auch, wenn man die beispiellose Promophase einmal ausblendet), dann nicht erst mit diesem Album, sondern auch schon vorher. Wenn man überhaupt irgendetwas zu kritisieren finden will, dann bleibt einem höchstens das seltsame Gefühl, das sich gemeinhin einstellt, wenn etwas fast schon zu perfekt, zu glatt daherkommt. „King“ ist wie alle Werke des Bosses sehr perfektionistisch bis ins Detail, hier sitzt jede Silbe, jede Zeile, jede Line, nichts wird dem Zufall überlassen.
Kollegahs Flow ist wie eine gigantische, komplex programmierte Maschine, die allerdings, und das wäre der zweite mögliche Kritikpunkt, meist recht monothematisch die oben erwähnten, immergleichen drei Topics ausspuckt. Caspers Reibeisenstimme auf „Karate“ oder ein Chaot wie Favorite wirken da zwischendurch durchaus erfrischend – obwohl letzterer sich die kalkulierten Tabubrüche mit jüdischem Anwalt (gähn) und Zinssatz auch ohne Verlust hätte sparen können. Trotz der gezielt gestreuten persönlichen Zwischentöne bleibt Kollegah als Rapper immer die Superhelden-Actionfigur: Unverletztlich, unantastbar, übermächtig, dabei ein wenig kühl und unpersönlich. Eher Musik für den Kopf als fürs Herz, wobei ersterer nicht durch allzu viele ausgefallene Thematiken strapaziert, sondern durch eine nahezu vollendete Ausführung überrascht wird.
Kollegah „King“ hier kaufen

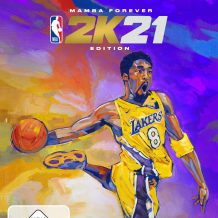



![Private Paul – Das Leben ist schön (prod. Private Paul) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Private-Paul-Das-Leben-ist-schön-218x218.jpg)
![Gringo feat. Brudi030 – Super Sonic (prod. Goldfinger) [Audio]](https://rap.de/wp-content/uploads/Super-Sonic-218x218.png)

![Ali As – Red Bottoms (prod. Young Mesh) [Video]](https://rap.de/wp-content/uploads/Ali-As-218x218.jpeg)






